Als Unternehmer musst du verstehen, wie Umsatzsteuer und Vorsteuer zusammenwirken. Vorsteuer ist die Steuer, die du beim Einkauf zahlst und später mit der eingenommenen Umsatzsteuer verrechnest.
In Deutschland gelten zwei Sätze: 19 % und 7 %. Das beeinflusst direkt deine Berechnung und damit die Zahllast gegenüber dem Finanzamt.
In der Buchhaltung steht die gezahlte Steuer als Forderung auf dem Aktivkonto „Vorsteuer“, bis sie mit der vereinnahmten Umsatzsteuer saldiert wird. So ergibt sich am Ende die tatsächliche Zahlung oder Erstattung.
👆 Das Wichtigste in Kürze
- Du lernst, was Vorsteuer ist und wie sie zur Umsatzsteuer steht.
- Die Differenz zwischen eingenommener Umsatzsteuer und gezahlter Vorsteuer bestimmt deine Zahllast.
- 19 % und 7 % Steuersätze beeinflussen die Höhe der abzugsfähigen Beträge.
- Die Vorsteuer wird auf dem Aktivkonto erfasst, bis sie mit der Umsatzsteuer verrechnet ist.
- Vollständige Rechnungen sind entscheidend für den Vorsteuerabzug.
Vorsteuer vs. Umsatzsteuer: Grundlagen, Steuersätze und Berechtigung
Verstehe den Unterschied zwischen der Umsatzsteuer, die du einziehst, und der Steuer, die du auf Einkäufe zahlst.
Als Unternehmer zahlst du beim Einkauf eine Steuer, die du später geltend machen kannst. Diese gezahlte Steuer nennt man vorsteuer. Die Umsatzsteuer erhebst du hingegen auf deine eigenen Lieferungen und Dienstleistungen gegenüber Kunden.
Es gibt zwei wichtige Steuersätze: den Regelsteuersatz von 19 % und den ermäßigten Satz von 7 %. Lebensmittel, Bücher und einige Leistungen fallen oft unter 7 %. Die Wahl des Steuersatzes beeinflusst direkt deine Abzugsfähigkeit.
Vorsteuerabzugsberechtigt sind grundsätzlich umsatzsteuerpflichtige Unternehmen. Nutzt du die kleinunternehmerregelung, weist du keine Umsatzsteuer aus und hast keinen Anspruch auf Vorsteuer. Wichtig sind vollständige Rechnungen mit Steuernummer oder USt‑IdNr. und Leistungszeitpunkt.
| Aspekt | Was gilt | Folge für dich | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Steuerart | Umsatzsteuer vs. Vorsteuer | Verrechnung in der Buchhaltung | Verkauf an Kunden vs. Einkauf |
| Steuersätze | 19 % / 7 % | Bestimmt Höhe des Abzugs | Lebensmittel 7 % |
| Berechtigung | Umsatzsteuerpflichtige Unternehmen | Anspruch auf Vorsteuerabzug | Kleinunternehmer: kein Abzug |
Vorsteuer berechnen: Schritt-für-Schritt mit Formel, Dreisatz und Beispiel
Mit einfachen Formeln und einem Dreisatz kannst du schnell den richtigen Steueranteil für Eingangsrechnungen finden.
Vorsteuer aus dem Nettobetrag
Die Formel ist simpel: Vorsteuer = Nettobetrag × Steuersatz. Bei 19 % heißt das z. B. 1.900 € × 19 % = 361 €.
Vorsteuer aus dem Bruttobetrag (Dreisatz)
Hast du nur den Bruttobetrag, rechnest du per Dreisatz: Netto = Brutto × 100/119 (bei 19 %) oder × 100/107 (bei 7 %).

Gemischte Steuersätze aufteilen
Bei gemischten Leistungen musst du die Nettoposten getrennt ausweisen. Beispiel: Lebensmittel 7 % und Verpackung 19 %.
Trenne jeden Nettobetrag und wende den passenden Steuersatz an, sonst wird die Vorsteuerberechnung fehlerhaft.
Praxisbeispiel: Differenz und Zahllast
Vereinnahmte Umsatzsteuer (z. B. 1.000 €) minus gezahlte Vorsteuer (z. B. 150 €) = Differenz 850 €. Bei positiver Differenz zahlst du diesen Betrag ans Finanzamt.
- Dokumentiere die Herleitung.
- Prüfe Steuersätze auf jeder Rechnung.
- Buche die Beträge periodisch, damit deine Zahllast planbar bleibt.
Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug: Rechnungsangaben, Nachweise und Timing
Nur mit vollständigen Rechnungen sicherst du dir den Anspruch auf Abzug gegenüber dem Finanzamt. Achte daher auf Form und Frist, damit dein Anspruch rechtssicher bleibt.
Kleinbetragsrechnung bis 250 €
Bei Belegen bis 250 € reicht eine Kleinbetragsrechnung. Diese muss Name und Anschrift des leistenden Unternehmens, Ausstellungsdatum, eine handelsübliche Leistungsbezeichnung, den Bruttobetrag und den angewandten Steuersatz enthalten.
Rechnungen über 250 €
Bei Rechnungen über 250 € sind weitere Angaben Pflicht. Du brauchst eine fortlaufende Rechnungsnummer, den Leistungszeitpunkt sowie die Steuernummer oder USt‑IdNr., damit du die Vorsteuer geltend sicher dokumentierst.
Zeitliche Zuordnung und Voranmeldung
Die Vorsteuer ordnest du dem Voranmeldungszeitraum zu, in dem dir die Rechnung zugeht. Ausnahmen sind Anzahlungen und Vorausleistungen: Diese gelten erst mit Zahlungseingang.
Bei SOLL-Versteuerung wird Umsatzsteuer mit Rechnungsstellung fällig; bei IST erst mit Zahlungseingang.
- Praktisch: Prüfe Steuersatz und die Bezeichnung der Lieferungen/Leistungen.
- Plane Belege monatlich, damit die Umsatzsteuervoranmeldung korrekt gelingt.
Buchhaltung und Kontierung: Vorsteuerkonto, Vorsteuerüberhang und USt-Verrechnung
Klare Kontenstrukturen machen sichtbar, ob dein Unternehmen eine Forderung gegen das Finanzamt hat oder eine Zahllast entsteht.
Vorsteuer als Forderung buchen
Du buchst die Vorsteuer im Soll auf dem Aktivkonto „Vorsteuer“. So zeigst du die Forderung, die später mit der vereinnahmten Umsatzsteuer verrechnet oder erstattet wird.
Überhang oder Zahllast erkennen
Am Periodenende schließt du Vorsteuer- und Umsatzsteuerkonten über das Umsatzsteuerverrechnungskonto. Bei einem Vorsteuerüberhang weist du eine Forderung in der Bilanz aus.
Bei höherer vereinnahmter Umsatzsteuer entsteht dagegen eine Verbindlichkeit. Das zeigt die genaue Höhe deiner Steuerpflicht gegenüber dem Finanzamt.
Umsatzsteuervoranmeldung: Rhythmus und Fristen
Die umsatzsteuervoranmeldung erfolgt i. d. R. monatlich oder quartalsweise, abhängig von der Zahllast des Vorjahres. Abgabe ist meist bis zum 10. des Folgemonats. Eine Dauerfristverlängerung kannst du beantragen.
Schließe Konten rechtzeitig und plane den Aufwand für Belegprüfung, damit die Meldungen fristgerecht beim Finanzamt ankommen.
- Führe 19 % und 7 % getrennt, damit Auswertungen sauber bleiben.
- Kommuniziere bei Rückfragen aktiv mit dem Finanzamt.
- Beispiel: Mehr Umsatzsteuer als Vorsteuer = Zahllast; umgekehrt = Vorsteuerüberhang.
Sonderfälle, Grenzen und typische Fehler bei der Vorsteuerberechnung
Manche Sonderfälle können dein Steuerbild stark verändern und müssen deshalb klar geregelt sein.
Kleinunternehmerregelung: Wenn du die kleinunternehmerregelung anwendest, weist du keine Umsatzsteuer aus. Folge: Du hast keinen Anspruch auf den Vorsteuerabzug. Prüfe jährlich, ob die Voraussetzungen noch gelten.
Private und steuerfreie Umsätze
Bei privaten Anschaffungen oder steuerfreien Leistungen (z. B. bestimmte medizinische Fälle) darfst du keine Vorsteuer ziehen. Trenne solche Ausgaben klar von deinem unternehmerischen Bereich.
Reverse-Charge-Verfahren
Beim Reverse-Charge-Verfahren schuldet der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer. Bei innergemeinschaftlichen lieferungen leistungen kannst du gleichzeitig die Vorsteuer geltend machen, sofern USt‑IdNr. und Formalia stimmen.
Typische Fehler
- Unvollständige rechnungen mit fehlender USt‑IdNr. oder Leistungszeitpunkt.
- Falsche Steuersätze (19 % vs. 7 %) bei bestimmten lieferungen leistungen.
- Falscher Zeitraum: Anzahlungen oder Zuordnung zur falschen Voranmeldung.
| Problem | Auswirkung | Praxis-Tipp | Häufigkeit |
|---|---|---|---|
| Kleinunternehmerregelung | Kein Abzug möglich | Jährlich prüfen | Häufig |
| Private/steuerfrei | Abzug ausgeschlossen | Trennung buchen | Regelmäßig |
| Reverse-Charge | Steuerschuldumkehr | USt‑IdNr. prüfen | Gelegentlich |
| Fehlerhafte Rechnungen | Abzugsverlust | Checkliste vor Buchung | Sehr häufig |
Fazit
Ein strukturierter Prozess macht die Verrechnung von Umsatzsteuer und gezahlter Vorsteuer planbar. Achte auf vollständige Rechnungen und die korrekten Steuersätze (19 % / 7 %), damit dein Anspruch auf Vorsteuerabzug gesichert bleibt.
Die Differenz zwischen vereinnahmter Umsatzsteuer und gezahlter Steuer ergibt den Betrag, den du ans Finanzamt zahlst oder als Forderung ausweist. In der Buchhaltung wird die gezahlte Steuer als Forderung geführt und periodisch mit der Umsatzsteuer verrechnet.
Berücksichtige Sonderfälle wie Reverse‑Charge und die Kleinunternehmerregelung. So bleibt deine Vorsteuerberechnung übersichtlich und die Umsatzsteuervoranmeldung fristgerecht.

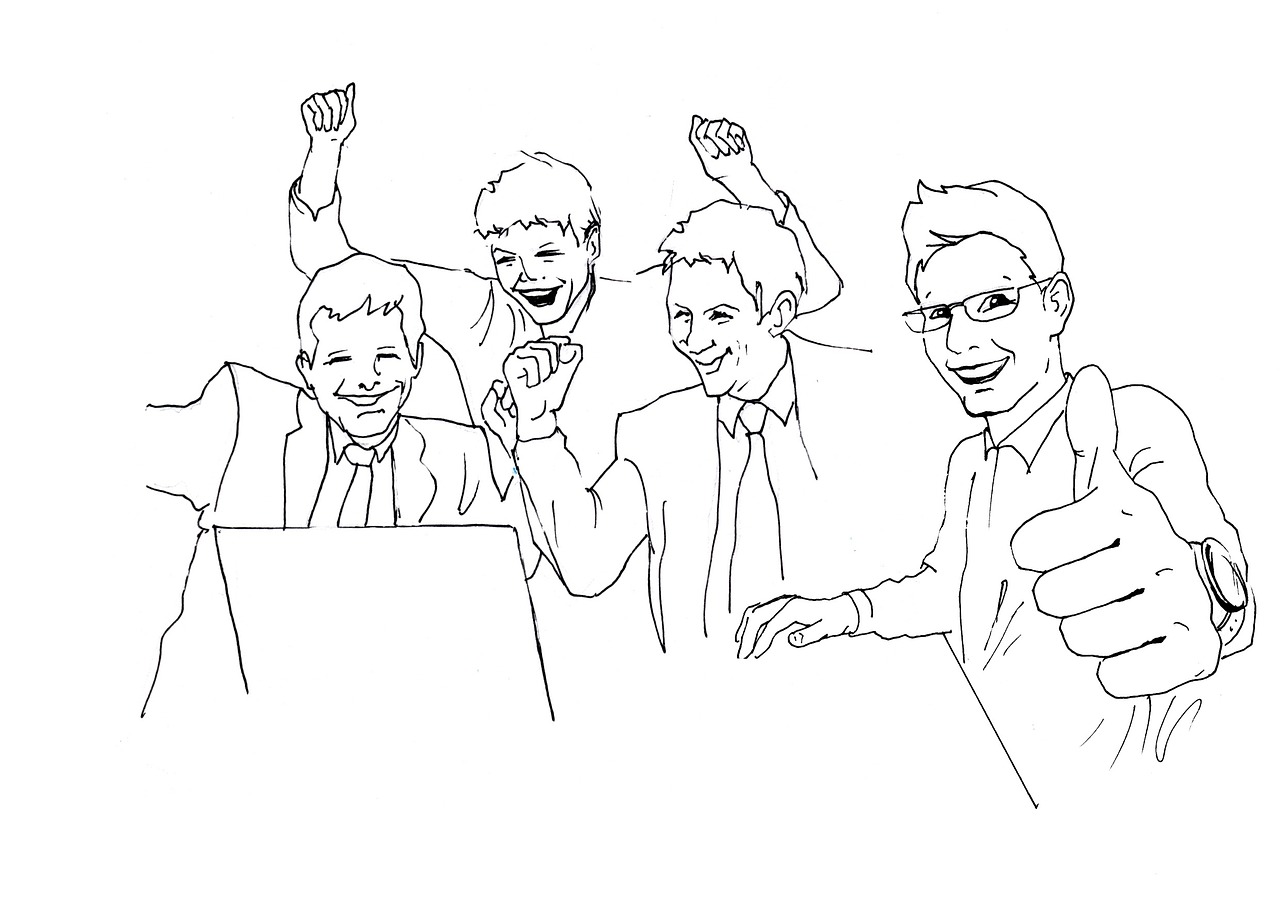





Als Selbstständiger mit ausgelagerter Buchhaltung habe ich gelernt: Auch wenn der Steuerberater alles übernimmt, lohnt sich ein kurzer Blick auf drei Dinge – sonst zahlt man drauf.
Erstens prüfe ich jede Rechnung vor dem Weiterleiten auf den richtigen Steuersatz (7 % für digitale Produkte wie E-Books, 19 % für Dienstleistungen?) und die Vollständigkeit der Angaben (USt-ID, Rechnungsnummer, Leistungsdatum – eine fehlende Rechnungsnummer hat mich mal 300 € Vorsteuerabzug gekostet!). Zweitens achte ich besonders auf „gemischte Rechnungen“ (z. B. Domain + Hosting in einer Rechnung), da diese oft falsch zugeordnet werden. Und drittens kontrolliere ich einmal im Monat, ob alle eingereichten Belege korrekt verbucht wurden – denn „ausgelagert“ bedeutet nicht „fehlerfrei“.